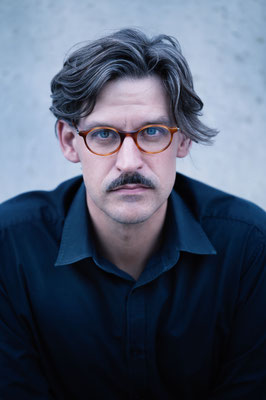2025
„Konstellationen“ - Konzept
Zusammenfassung
In „Konstellationen“ dreht sich die Handlung um die Beziehung zwischen Roland, einem Imker, und Marianne, einer Quantenwissenschaftlerin. Dabei wird die Idee von Multiversen und Parallelwelten erforscht. Die Dialoge und Szenen werden in verschiedenen Varianten präsentiert, wodurch die Zuschauenden verschiedene Versionen der Geschichte erleben können. "Konstellationen" erkundet Themen wie Liebe, Schicksal und die Unendlichkeit der Möglichkeiten in unserem Leben, indem es die Idee der Quantenmechanik in die Welt der Beziehungen einbringt.
Motivation
Für mich liegt der Reiz dieses Stückes in den verschiedenen Versionen und Varianten der einzelnen Szenen. Ich finde es unglaublich interessant, Szenen die fast identisch geschrieben sind, mehrmals hintereinander zu sehen und doch immer ein anderes Ergebnis zu erleben, gleichzeitig neue Seiten der beiden Charaktere zu entdecken. Darin liegt die Stärke dieses Stückes.
Die Zuschauenden bekommen immer wieder neue Möglichkeiten sich mit den Figuren und der Handlung zu identifizieren. Es zeigt gleichzeitig auf, wie schnell sich alles ändern kann. Eine andere Betonung, ein anderes Satzzeichen und eine andere Emotion, schon geht die vorher liebevoll gespielte Romanze in die Brüche.
Durch die vielen verschiedenen Szenen in den unterschiedlichen Phasen gibt es keinen „wahrhaftigen“ roten Faden. Jede zuschauende Person kann sich aus den einzelnen Szenen, die herausnehmen, die am meisten berühren und somit eine eigene Geschichte erleben, eine eigene Dramaturgie erschaffen.
„Konstellationen“ ist ein qualitativ hochwertiges Stück, welches kein Konzeptkorsett übergestülpt braucht, sondern durch eine zarte Führung und hervorragende Spieler:innen, auftrumpfen wird.
Spielweise
Durch ein pures psychologisches Spiel haben die spielenden Kolleg:innen extrem viele Möglichkeiten sich zu präsentieren und ihr Können unter Beweis zu stellen. Es wird ein präzises und sensibles Spiel verlangt. Der Fokus muss immer auf dem Spiel miteinander liegen. Es braucht wenig Ablenkung von außen, denn was zählt, ist nur die Spannung zwischen den Beiden. Durch die Natürlichkeit, die Direktheit und die Transparenz der Kolleg:innen auf der Bühne, wird es den Zuschauenden leichter fallen sich angesprochen zu fühlen, sich auf das Stück einzulassen und mitzufühlen.
Umsetzung
Zu Beginn des Originalstücks lernen sich beide Charaktere bei einer Gartenparty unter einem Regenschirm kennen. Ich kann mir gut vorstellen den Abend auf der Bühne mit einem ausgelassenen Tanz zu eröffnen. Energetisch kann ich die Spieler:innen gleich auf ein hohes Level bringen und durch ein Abbrechen des Tanzes, ein erstes Kennenlernen, in der Verschnaufpause etablieren:
Wir sehen eine leere Bühne und es ist dunkel. Laute elektronische Musik ertönt. Beide Spieler:innen tanzen sich auf die Bühne. Einzelne Lichtblitze oder kurzes aufleuchten der einzelnen Leuchtmittel (siehe Licht) lassen die Spieler:innen in kurzen Momentaufnahmen (stroboskopischer Effekt) unabhängig voneinander, ganz mit sich selbst und der Musik beschäftigt, erscheinen. Irgendwann erstirb die Musik abrupt und Beide treffen sich unter der einzigen Lichtquelle und beginnen die ersten Szenen.
Im Originalstück bekommt man immer wieder Szenen zu sehen, die nur leicht voneinander abweichen und die aus verschiedenen Phasen der Beziehung Beider sind. Es gibt Handlungsverläufe, die in einer Szene angerissen und die dann nie weitergeführt werden. Gleichzeitig gibt es Szenen, die in späteren Phasen weitergespielt werden. Die Zuschauenden beobachten dabei, wie die Beiden Spielenden verschiedene Stufen in ihrer Beziehung erreichen und durchlaufen.
Gerade am Stückbeginn möchte ich für die vielen Szenenwechsel, Anfangspositionen für die Kolleg:innen auf der Bühne festlegen, von denen aus eine Szenen begonnen werden muss (z.B. „die Verschnaufpause“ nach dem Eröffnungstanz unter der ersten Lichtquelle). Das erleichtert den Zuschauenden das Verstehen des Spielkonzepts.
Im weiteren Verlauf des Abends kann das Prinzip aufgebrochen werden. Sollten sich aber Szenen einer neuen Phase, einer Szene aus einer vorherigen Phase anschließen, wäre es sinnvoll die Schlussposition eben dieser Szene, als Startposition wieder einzunehmen, um eine Kontinuität zu erhalten.
Die Platzwechsel der Spieler:innen, von Schlussposition der alten Szene auf Startposition der neuen Szene, eröffnet außerdem eine neue Spielebene, in der der Zuschauer intime Eindrücke der Spieler gewinnen kann. Es ist den Spieler:innen bei bestimmten Szenenwechseln erlaubt, die Emotion in die neue Szene mitzunehmen, beziehungsweise der vorherigen Emotionen noch viel Raum zu geben. Dabei ist die Geschwindigkeit, mit der die Kolleg:innen die neue Position einnehmen, eine tolle Form für Beobachtungen:
Eine hoch emotionale Szene wird gespielt und findet einen Abschluss. Roland nimmt die Wut, die Enttäuschung und die hohe Energie mit, um sich auf die Startposition der nächsten Szene zu begeben. Er ist schnell und zügig auf der Position, fixiert Marianne und wartet auf sie. Marianne aber muss/möchte das Erlebte noch verarbeiten und nimmt sich die Zeit, die sie braucht, bevor sie auf die Startposition der nächsten Szene geht. Selbst in diesem Beobachten und Wahrnehmen der Kolleg:innen im Zwischenspiel steckt viel Spiel.
Kostüm
Ich möchte Beide in unauffälligen, schlichten, neutralen Kostümen auf der Bühne sehen. Vielleicht haben sie sogar das Gleiche an.
Es darf kein klares Rollenbild oder Klischee Stereotype erzählt werden.
Licht
Ich möchte gerne auf einer dunklen Bühne starten und für jeden Szenenwechsel eine neue Lichtquelle dazu schalten. Gerade für die erste Szene haben wir ein schönes Bild, wenn man die tanzenden Kolleg:innen im Raum erahnt und sich dann Beide für den Beginn der ersten Szene um eine Lichtquelle drängen.
Des Weiteren erinnern viele einzelne Lichtquellen an unseren Sternenhimmel, also das Universum.
Am Ende des Stückes muss der Raum Licht geflutet sein. Gerne auch überbelichtet. Eine tolle Symbolik, die für die sterbende Marianne steht, für den „Himmel“, ein steriles Krankenhauszimmer, sowie für Licht, das immer auch Hoffnung verspricht.
Im Schlussbild trifft Marianne die Entscheidung, die letzte, noch verbliebene, ausgeschaltete (wahrscheinlich exponiert stehende und beim Thema Krankheit vielleicht vorher leicht angespielte) Lichtquelle zu aktivieren. Nach dem anschalten kommt es langsam zu einer Überbelichtung der Bühne. Am Punkt der maximalen Helligkeit gibt es das „Black“. Stückschluss.
Musik
Ich kann mir gut vorstellen vereinzelt Musik einspielen zu lassen. Aber nur als ein Klangteppich. Vielleicht als Dopplung der vorher gesehenen-, oder noch kommenden Emotion, aber vielleicht auch eher genau im Gegensatz dazu.
Außerdem kann ich mir vorstellen, eine hohe emotionale, intime Nähe der Spieler:innen, zu übersetzen mit einem kleinen Gesang. Anstatt sich küssende und sexuell agierende Spieler:innen zu sehen, möchte ich lieber sehen, wie beide sich ganz vertraut, mit viel Verständnis und Humor, einzelne Zeilen aus einem Lied zitieren. Gerade die Unbeholfenheit, die Peinlichkeit und der Versuch, erzeugen eine tiefe Zuneigung. Ich glaube, dass hat eine höhere Wirkung als jede „reale“ erotische Körperlichkeit.
Bühnenbild
Ich möchte eine leere Bühne haben, also einen freien neutralen Raum. Gerne möchte ich mich da aber austauschen mit einem Bühnenbildner:in.
Probenprozess
Der Fokus liegt auf dem puren Spiel der Beiden.
Außerdem möchte ich noch mehr Symbole und Übersetzungen für die Themen der Figuren finden. Imkerei, Quantenmechanik beziehungsweise Multiversen und Paralleluniversen.
Und wahrscheinlich werde ich noch einzelne Szenen streichen beziehungsweise umstellen, um einen für mich saubereren dramaturgischen Bogen zu kreieren. Einiges kann ich im Vorfeld entscheiden, manches kann ich aber erst im Probenprozess überprüfen.
Fazit
„Konstellation“ ist eine Liebeserklärung an das Leben, an das Theater und an die Spieler:innen auf der Bühne.